Heimat, nur noch auf Fotopapier
Ein paar Jungs spielen Fußball, daneben sitzt der Gewürzhändler zwischen prall gefüllten Säcken, fast glaubt man, den Duft seiner Ware erschnuppern zu können. Da ist der Tuchhändler, umgeben von farbenfrohen Ballen, in einer Werkstatt fliegen die Späne, der Bäcker backt. Frauen nähen, alte Männer trinken Tee und reden jeden Tag über die gleichen Dinge. Alltag, wie er so oder ähnlich überall stattfindet. Eine Welt, die es nicht mehr gibt. Zu dem, was an sie erinnert, gehören die Bilder von Bahaa Al Masri, die er kürzlich in der ehemaligen Kapelle der Olper Zentralen Unterbringungs-Einrichtung (ZUE) „Regenbogenland“ ausstellen durfte. Seit Februar lebt der 33-jährige Syrer hier. Ich besuche ihn, um die Geschichte hinter seinen Bildern zu hören – und nach einem freundlichen Handschlag („Hi, I’m Bahaa“) erzählt er sie gern, so wie er sie in den Tagen zuvor auch anderen Besuchern erzählt hat.
„Mein Kind denkt, es spricht mit einem Spielzeug“
Natürlich gleicht das Schicksal Bahaas und seiner Familie dem anderer Menschen, die aus dem umkämpften Syrien fliehen mussten oder noch innerhalb des Landes auf der Flucht sind: Angst, Ungewissheit, die Trennung von seinen Lieben, das Gefühl der Entwurzelung. Ob in den heimischen Flüchtlingsunterkünften, in Lagern in Griechenland oder auf der Balkanroute – überall sind einander ähnelnde Varianten des Leids zu hören. Unberührt lässt es einen nie.
„Ich habe meine Frau und meine Kinder in der Türkei zurückgelassen“, erzählt Bahaa nüchtern, während wir gemeinsam seine Bilder betrachten. Die Nachrichten vom Putschversuch waren ein Schock, inzwischen konnte er aber mit seiner Familie sprechen. Es sind noch andere Besucher zugegen, eine Frau hat Fragen, Bahaa beantwortet sie höflich. „Kannst du kurz übersetzen“, fragt er mich. Er lernt Deutsch, doch um sein Leben zu erzählen, reicht es noch nicht. Sein Kind irgendwo in der Türkei lernt gerade sprechen und kennt den Vater nur vom Handy. „Es denkt, es spricht mit einem Spielzeug“, sagt Bahaa.
“Keine normalen Erinnerungsfotos”
Als er dringend Unterstützung benötigte, um seiner Familie, zu der auch die Eltern seiner Frau zählen, wenigstens ein Dach überm Kopf mieten zu können in der Türkei, wandte er sich in seiner Verzweiflung an einen Freund in Frankreich. Sehr lange hatten Alexander und Bahaa nichts mehr voneinander gehört, am Telefon flossen Tränen. Alexander half, und mehr noch: Er erinnerte sich der Bilder, die er und seine Familie bei ihren Syrienbesuchen 2005 und 2006 gemeinsam mit Bahaa, dem ambitionierten Hobbyfotografen, geschossen hatten: Hochwertige Porträts des Alltags in Jarmuk, teils gestellte, zumeist aber ungestellte Aufnahmen, die heute Einblicke in das Leben vor der Zerstörung ermöglichen. „Eigentlich waren sie nur als ganz normale Erinnerungsfotos gedacht…“ – der Rest des Satzes hängt in der Luft: dass sie unvermutet zu letzten Zeugnisse von etwas wurden, das es so nicht mehr gibt. Alexander und seine Familie setzten sich ins Auto und brachten die gerahmten Bilder nach Olpe. Ein bewegendes Wiedersehen, denn: „Sechs Monate hat er bei mir im Haus gewohnt, dann haben wir uns zehn Jahre aus den Augen verloren.“
„Ein gutes, einfaches Leben“
Bahaa und seine Familie entkommen dem IS, seine Eltern, beide 60, muss er zurücklassen. „Viele alte Leute weigern sich, zu gehen“, nickt Bahaa, als wir vor dem Bild der Männer stehen, die sich jeden Tag trafen, um die gleichen Geschichten zu erzählen. Viele Alte möchten lieber in der Heimat sterben als irgendwo in der Fremde.
Auf dem Foto darunter sind fröhliche Kinder zu sehen, die etwas für den Betrachter Unsichtbares anstaunen. „Da hat Alexander bei seinem Besuch Zirkus gemacht“, erzählt Bahaa und schleudert imaginäre Bälle in die Luft. So etwas war den Mädchen und Jungen aus seiner Gegend ganz neu, ihre Augen leuchteten. Sie sind jetzt keine Kinder mehr, aber wo sind sie jetzt? Ein paar Jungs spielen konzentriert Schach – eine der wenigen Ablenkungen für sie, von Jugendzentren oder etwas in der Art keine Rede. Im Winter, erklärt Bahaa, gingen die Kinder zur Schule, im Sommer halfen sie, zum Lebensunterhalt beizutragen, indem sie Flaschen sammelten beispielsweise – auch davon zeugt ein Foto.
Unvorstellbar für westliche Verhältnisse, in Syrien normal.
Die Gegend sei arm gewesen, berichtet Bahaa, ja, aber: „Wir hatten ein gutes, einfaches Leben.“ Ein Mann arbeite zehn bis 15 Jahre, dann habe er das nötige Geld für ein Haus zusammen. „Viele dieser Häuser waren illegal“, grinst Bahaa. Innerhalb von nur 24 Stunden hochgezogen, konnten sie nicht mehr abgerissen werden, sobald eine Familie darin lebte. Es versteht sich von selbst, dass der „Einzug“ sehr häufig ohne jegliches Mobiliar vonstatten ging.
In alle Richtungen verstreut
Wir kommen zu einer Aufnahme mehrerer junger Männer: „Das sind meine Freunde.“ Einer macht Musik, von einem anderen sind nur die Beine zu sehen, auf dem Boden steht das Tablett mit dem unvermeidlichen Tee. Es hat sie alle als Flüchtlinge in den Libanon verschlagen, nach Schweden, Frankreich und nach Deutschland. Auf einem Foto ist Bahaas Schwester abgebildet – die stille Aufnahme eines für seine damals zwölf Jahre reif wirkenden Mädchens. Inzwischen ist sie 21 und studiert, so wie auch Bahaa studiert hat: Er ist Lehrer für Geographie. Wer in seiner Heimat ungestört lernen wollte, konnte das bei dem hohen Geräuschpegel im eigenen Haus und den dicht an dicht stehenden Gebäuden oft vergessen. Dafür gab es eigene Studierhäuser. Auf einem Bild aus einem solchen Studierhaus sitzt ein junger Mann konzentriert über seinem Buch. In einer Apotheke verteilt der Rothalbmond, das Pendant zum Roten Kreuz, kostenlose Medikamente.
Feilschen und Handeln
Wer wollte, konnte unkompliziert schnelles Geld machen: Saftpresse auf einen Tisch, ein paar Zitronen, die Limonade daraus war an heißen Tagen entsprechend begehrt. Dafür habe man keine Konzession benötigt, erklärt Bahaa, als wir vor dem Bild stehen. Es finden sich einige Marktstände wieder in der Sammlung. Hier wurde gefeilscht und gehandelt, undenkbar in den schicken, teuren Läden, von denen es ebenfalls Momentaufnahmen gibt.
Frauen fertigen Näharbeiten, doch die Maschine ist nur für die Umrandung gedacht: „Das da“, sagt Bahaa und deutet auf die feine Kreuzstickerei in der Mitte des abgebildeten Tuchs, „machten sie mit der Hand, auch bei sehr schlechter Beleuchtung. Das war sehr schlecht für ihre Augen.“
„Ich will eine Zukunft für meine Kinder“
Inzwischen lebt nur noch ein Bruchteil der Menschen, die früher hier lebten, in Jarmuk. Bahaas etwa zwei Quadratkilometer großes Stadtviertel von Damaskus und Flüchtlingslager, war im vergangenen Frühling komplett von IS-Extremisten eingeschlossen, die syrische Armee kündigte eine Rückeroberung an. US-Generalsekretär Ban Ki Moon sprach von einer „Katastrophe epischen Ausmaßes“, die sich hier ereigne. Bis 2012 lebten rund 120.000 Menschen in diesem Viertel, im vergangenen Jahr waren es noch etwa 16.000, darunter 3500 Kinder. Bahaa hat seine Familie in der Türkei zurückgelassen, er ging voraus, weil er dachte, es gehe schnell in Deutschland: „Ich habe meiner Frau Hoffnung gemacht.“
Jetzt wartet er erst einmal darauf, dass über seinen eigenen Antrag entschieden wird. Er sagt: „Ich kann alles arbeiten. Ich kann auf engstem Raum leben. Ich brauche nur eine Mahlzeit am Tag. Aber ich will eine Zukunft für meine Kinder.“ Vorerst bleibt ihm nur, zu warten. „Vielleicht werde ich nächste Woche transferiert, vielleicht bleibe ich hier.“ Im Rebola gefällt es ihm, die Menschen dort seien sehr nett.
Bahaa ist, wie die meisten aus Jarmuk, Nachfahre palästinensischer Flüchtlinge – eine bittere Ironie, über die er durchaus lachen kann. Sein Viertel, wie es war, gibt es nur noch auf Bildern.
Und trotzdem:
„Glaub mir: Ich würde zurückgehen.“
Text: Nicole Klappert






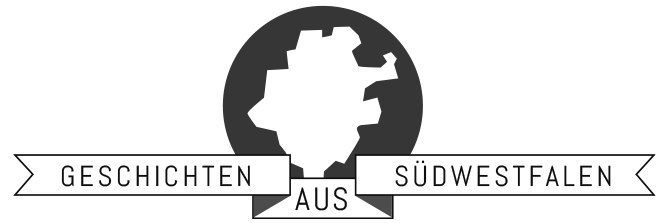
Schreibe einen Kommentar
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.